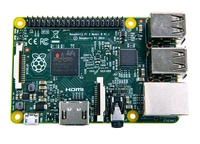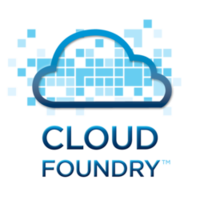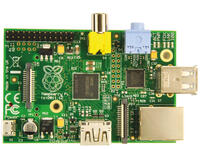Linux-Distributionen für IoT

Zwergenaufstand
Das Thema Linux im Embedded-Bereich lässt sich in drei Gruppen ordnen. Der Klassiker sind dabei "Binary-based Distributions", die in Form von Binärdateien daherkommen. Soll hier ein neues Programm hinzugefügt werden, ist keine Kompilation erforderlich. So gut wie alle am Desktop verbreiteten Distributionen sind nach diesem Modell aufgebaut und wer beispielsweise am PC mit Debian Erfahrung hat, hat auf einem Prozessrechner mit einem Debian-Derivat kaum Startschwierigkeiten.
Die beiden Nachteile binär-basierter Distributionen sind offensichtlich: Erstens sind sie vergleichsweise umfangreich. Während das Mitschleppen einiger Applikationen auf einem PC keinen großen Ärger verursacht, führt das Erreichen einer Speichergrenze im Embedded-Bereich zu Mehrkosten. Zweitens erfolgt die Kompilation der Pakete meist mit "vernünftigen Standard-Einstellungen", bei denen die Hersteller der Distribution besondere Aspekte bestimmter Controller im Interesse besserer Breitenverfügbarkeit ignorieren. Der Vorteil davon ist zwar, dass sich neue Software auf binär-basierten Distributionen leicht installieren lässt – andererseits sind sie weniger effizient.
...Der komplette Artikel ist nur für Abonnenten des ADMIN Archiv-Abos verfügbar.